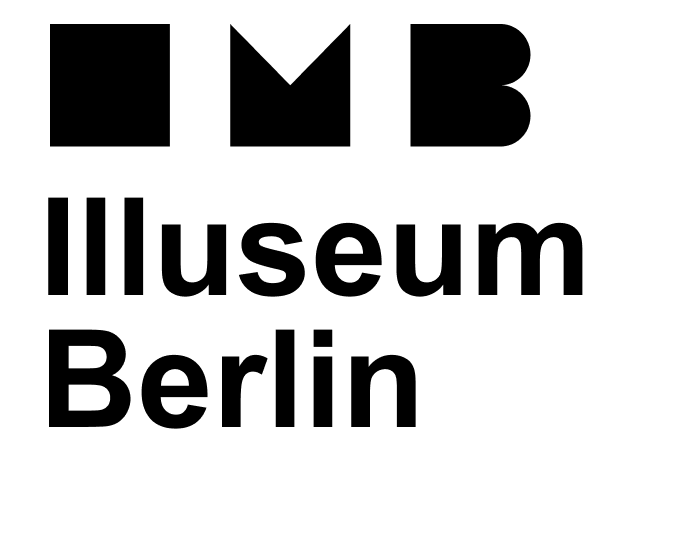Diese Kunstform hat uns wie „Amor’s Pfeil“ mitten ins Herz getroffen. Wir erzählen dir, warum wir sie lieben und was sie so besonders macht.
Es gibt einige Kunstwerke im Illuseum Berlin, die seit Beginn an fixer Bestandteil unserer Ausstellung sind. Und dazu gehört ein original Reverspective-Gemälde von Patrick Hughes, worauf wir sehr stolz sind. Denn seine Werke findet man in London in den Sammlungen der British Library, dem V&A Museum und in der Tate Gallery of Modern Art und darüber hinaus – Trommelwirbel – bei uns in Berlin!
Sie basieren auf einer besonderen Form der Anamorphose und sind aufgrund ihres spielerischen, faszinierenden Charakters und ihrer surrealistischen Art aus der Kunstszene und aus unserem Museum nicht mehr wegzudenken. Mit seinen dreidimensionalen Werken und der einzigartigen Verwendung optischer Täuschungen, fordert Patricks Kunst den Betrachter heraus, sein eigenes Verständnis von Perspektive und Vision zu hinterfragen. Seine geometrisch abstrakte Kunst erzählt durch ihre Tiefe oft eine ganz eigene Geschichte. Also lasst uns eintauchen, in die Welt und in die Geschichte der Anamorphose.
Was bedeutet Anamorphose und wo hat sie ihren Ursprung?
Das Wort Anamorphose stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Umformung“. Sie setzt voraus, dass man Bilder nur unter einem bestimmten Blickwinkel oder mittels eines speziellen Spiegels oder Prismensystems erkennen kann.
Sie ist eine Kunstform, die mit optischen Täuschungen und verzerrten Perspektiven spielt und funktioniert nach dem Prinzip der Verzerrung: Ein Bild oder eine Skulptur sieht auf den ersten Blick verzerrt oder unverständlich aus, ergibt aber aus einer bestimmten Perspektive oder eben mit Hilfe eines Spiegels ein vollständiges, korrektes Motiv. Diese Technik wird in der Kunst, Architektur, Straßenmalerei und sogar in der Werbung eingesetzt, um verblüffende visuelle Effekte zu erzeugen.
Die Anamorphose ist jedoch keine neue Erfindung, denn sie hat eine lange Geschichte. Ihre Wurzeln liegen in der Renaissance, einer Epoche, in der Künstler und Wissenschaftler bereits intensiv mit Perspektiven und Optik experimentierten. Die ersten bekannten anamorphotischen Werke stammen aus dem 15. Jahrhundert und wurden unter anderem von Künstlern wie Leonardo da Vinci und Hans Holbein dem Jüngeren entwickelt.
In den Notizbüchern von Leonardo da Vinci finden sich Skizzen, die auf verzerrte Zeichnungen hinweisen, die nur mit Spiegeln oder aus bestimmten Blickwinkeln korrekt erscheinen. Ein berühmtes Beispiel ist das Gemälde Die Gesandten (1533) von Hans Holbein der Jüngere, auf dem ein verzerrter Totenkopf zu sehen ist. Erst aus einem bestimmten Blickwinkel oder mit einem Spiegel betrachtet, wird der Schädel als Memento Mori – eine Erinnerung an die Vergänglichkeit – erkennbar.
Etwa 100 Jahre später nutzte der italienische Maler und Architekt Andrea Pozzo die Technik der Anamorphose für illusionistische Deckengemälde in Kirchen, die perspektivisch so gestaltet sind, dass sie unendliche Weiten suggerieren und sich nur aus einer bestimmten Position zu einem realistischen Gesamtbild fügen. Sein berühmtestes Werk ist die Deckenfreske in der Kirche Sant’Ignazio in Rom. Ein „must see“ für Kunsthistoriker und Kunstliebende!
Im 20. und 21. Jahrhundert wurde die Technik in der modernen Kunst, Architektur und Werbung weiterentwickelt. Patrick Hughes haben wir bereits erwähnt, aber auch durch Street-Art-Künstler wie Julian Beever und Felice Varini hat die Anamorphose neue Popularität gewonnen.
Wo und wie diese optische Täuschung unsere Wahrnehmung manipuliert.
Anamorphose spielt nicht nur in der Kunst eine Rolle, sondern beeinflusst auch unseren Alltag und unsere Wahrnehmung. Was für Mathematiker vielleicht völlig logisch erscheint, ist für andere eine reine „Verarsche“ unseres Gehirns.
Die Berechnung einer Anamorphose erfolgt mithilfe der Gesetze der Perspektive und Geometrie. Dabei wird das ursprüngliche Bild so verzerrt, dass es nur unter bestimmten Bedingungen wieder seine ursprüngliche Form annimmt. In der digitalen Kunst wird dies oft mit speziellen Programmen berechnet. In Filmen und Videospielen offenbaren sich verzerrte Logos oder versteckte Bilder erst aus der richtigen Perspektive.
Was kurios und witzig erscheint macht oftmals auch richtig Sinn! In der Straßenkunst verzerren 3D-Malereien unsere Sicht, weil sie nur aus einem bestimmten Winkel richtig wirken und auch genauso wirken sollen. Ein gutes Beispiel sind gemalte Verkehrszeichen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen, die nur aus Autofahrerperspektive gut lesbar sind. Durch die perspektivische Anamorphose ist das Bild eben so verzerrt, dass es nur aus einem bestimmten Blickwinkel oder einer bestimmten Position richtig erkennbar ist.
Bei der Spiegelanamorphose wird ein verzerrtes Bild erst sichtbar, wenn es in einem reflektierenden Zylinder, Kegel oder Prisma gespiegelt wird.
Und wenn wir bei Nacht unseren Blick in den Himmel werfen, dann finden wir in unserer menschlichen Wahrnehmung auch dort anamorphotische Effekte. Ein Beispiel ist der “Mond-Illusion”-Effekt: Der Mond erscheint am Horizont größer als hoch am Himmel, obwohl seine tatsächliche Größe unverändert bleibt. Krass oder?
Wir lieben Anamorphose und wir lieben die Natur – kein Wunder, dass wir auch hier einige Parallelen finden.
Anamorphosen gibt es nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Natur. In der Zoologie bezeichnet sie beispielsweise einen Vorgang der Larvalentwicklung von Tausendfüßern, bei dem die beinlosen Körperringe eines Stadiums im folgenden Stadium zu beintragenden Körperringen umgewandelt werden.
Viele Tiere haben außerdem Tarnmuster oder Körperstrukturen, die aus bestimmten Perspektiven eine optische Täuschung erzeugen.
Schmetterlinge und Insekten nutzen Flügelmuster, die aus bestimmten Blickwinkeln wie Augen erscheinen, um Fressfeinde abzuschrecken. Chamäleons und Tintenfische können ihre Hautstruktur und Farbe so verändern, dass sie sich in ihrer Umgebung “auflösen”. Und Zebras nutzen ihr Streifenmuster, um Raubtiere zu verwirren – aus der Entfernung verschwimmen nämlich ihre Umrisse.
Unser Fazit: Die faszinierende Welt der Anamorphose
Anamorphose war und ist immer schon da. Sie ist eine Kunstform, die seit Jahrhunderten existiert und immer wieder neu erfunden wird. Von den mathematischen Experimenten der Renaissance bis hin zu modernen Street-Art-Werken hat sie sich stetig weiterentwickelt und fasziniert nach wie vor Künstler und Betrachter.
Ob in der Natur, in der Kunst oder in der Wissenschaft – die Anamorphose zeigt, wie unsere Wahrnehmung durch Perspektive beeinflusst wird. Wer sich darauf einlässt, entdeckt ihre Schönheit in einer Welt voller optischer Illusionen und verblüffender Effekte.
Und genau deshalb lieben wir Anamorphose! Denn das Herz des Illuseum Berlin schlägt für Kreativität, Gemeinschaft und Umweltschutz. Für Kunst und Natur. Und beides kann sich gegenseitig so unendlich viel beitragen.